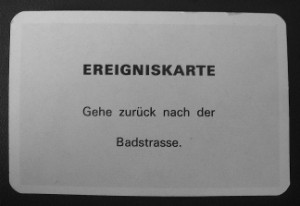 Einer Meldung des Handelsblattes entnehme ich, dass der BGH nach seiner heutigen Verhandlung die Revisionsklage (Az. XI ZR 378/13) im Fall Ennepetal gegen EAA zurück an das OLG Düsseldorf verwiesen hat.
Einer Meldung des Handelsblattes entnehme ich, dass der BGH nach seiner heutigen Verhandlung die Revisionsklage (Az. XI ZR 378/13) im Fall Ennepetal gegen EAA zurück an das OLG Düsseldorf verwiesen hat.
Da der BGH die Abschrift der Entscheidungsbegründung wie immer erst verzögert publiziert, ist die Meldungslage noch recht diffus. In der Medienberichterstattung wird insbesondere der heutige Hinweis des BGH, eine Aufklärungspflicht bestehe bei Derivaten mit konnexen Darlehensgeschäften nicht, als Rückschlag für viele klagende Kommunen aufgefasst. Die Pressemeldung des BGH selbst enthält jedoch auch Hinweise, die der Sache der Kläger durchaus zuträglich sind.
Gründe für die Rückverweisung ans OLG Düsseldorf
Die eingangs erwähnte Handelsblatt-Meldung spricht fälschlicherweise von einem “Urteil”. Der BGH sah aber die Tatsachenfeststellung durch das OLG Düsseldorf als unvollständig an und hat somit die Entscheidung getroffen, die Angelegenheit zur erneuten Verhandlung an das OLG Düsseldorf zurückzudelegieren. Offenbar hätte sich der XI. Senat gleich in mehreren ihm wichtigen Punkten eine umfangreichere Tatsachenerhebung gewünscht. So sah der BGH heute ersten Meldungen zufolge schon Nachbesserungsbedarf bei der Prüfung, ob überhaupt ein Beratungsvertrag zustande gekommen sei. Es ist daher nicht korrekt, von “Sieg” oder “Niederlage” einer Partei zu sprechen.
Gleichwohl hat sich der BGH in seiner Entscheidung zu mehreren Fragen positioniert, die bislang umstritten waren. Die Pressemitteilung Nr. 70/2015 enthält auch Feststellungen, die – anders als die Meldung im Handelsblatt vermuten lässt – durchaus im Sinne der klägerischen Argumentation sind.
Bankenfreundliche Elemente der heutigen Entscheidung
Keine Aufklärungspflicht über den negativen Marktwert bei konnexen Darlehen
Der BGH äußerte sich nach ersten Meldungen dahin gehend, dass bei Vorliegen eines konnexen Darlehensgeschäfts die Notwendigkeit zur Aufklärung des Kunden über einen anfänglich einstrukturierten negativen Marktwert nicht erforderlich sei. Da derartige Kundenderivate – wie bereits zuvor ausgeführt – fast immer im Rahmen einer kundenseitigen Darlehensanfrage vermarktet werden, ist zu befürchten, dass Mehrheit der anhängigen Derivatklagen an dieser heute vom BGH präzisierten Restriktion scheitern könnte. Die Bezugnahme auf ein konnexes Darlehen stellt in der Tat eine der dicksten Kröten dar, die hoffnungsvolle Kläger mit der heutigen Entscheidung schlucken mussten.
Irritierend für mich bei der Konnexitätsargumentation ist schon immer folgender Punkt gewesen: Ich kann nicht erkennen, inwiefern die Konnexität zwischen Derivat und einem etwaigen Darlehensbestand den grundsätzlich vom BGH im Jahr 2011 bemängelten Interessenkonflikt auflösen kann: Ein zur objektorientierten Beratung verpflichtetes Kreditinstitut rät einem Kunden zwecks Risikoreduktion bei einem Darlehen zu einer Kapitalmarktwette in Form eines Derivats, ohne dem Kunden offenzulegen, dass es die Bedingungen dieser Wette zuvor finanzmathematisch zu dessen Ungunsten manipuliert hat und diese Übervorteilung durch Hedge-Geschäfte am Kapitalmarkt sofort für sich selbst vereinnahmt.
Der BGH orientiert sich bei seiner Konnexitätsargumentation offenbar an einem Urteil des OLG Stuttgart (Urteil v. 27.06.2012, Az. 9U 140/11), das seinerzeit die Aufklärungspflicht über einen anfänglich von der Bank in einen Zinsswap einstrukturierten negativen Marktwert verneint hatte, weil ein konnexes Darlehen vorlag. Letzendlich – so damals die Stuttgarter Richter – würden ein variables (konnexes) Darlehen und das Derivat zusammen zu einem “synthetischen Festzinsdarlehen” verschmelzen, für das der Kunde jederzeit auch ohne finanzmathematische Spezialkenntnisse und -werkzeuge einen Konditionenvergleich mit anderen Festzinsdarlehen am Markt vornehmen könne. Mit anderen Worten: In einer solchen Konstellation wird eine etwaige Übervorteilung durch einen negativen Marktwert dermaßen offensichtlich, dass auch Laien ohne expliziten Hinweis der Bank in der Lage sind, diese Übervorteilung zu erkennen.
Ganz abgesehen davon, dass auch gegen diese Argumentation erhebliche Einwände vorgebracht werden können (ich werde mich dieser Thematik in den kommenden Tagen in einem separaten Beitrag zur Konnexität widmen), funktioniert sie wenn überhaupt nur, wenn das Derivat lediglich aus linearen (also nicht-optionalen) Komponenten besteht. Das ist aber bei den Ennepetaler Derivaten nicht der Fall. Erschwerend kommt hinzu, dass diese Komponenten mitunter auch noch pfadabhängig sind, also noch nicht einmal analytisch ermittelbar sind. Von einer Offensichtlichkeit des negativen Marktwertes, die der Kunde auch selbst hätte erkennen können, kann also nicht die Rede sein. Damit steht die Konnexitätsargumentation – jedenfalls so wie sie damals vom OLG Stuttgart postuliert worden ist – auf tönernen Füßen.
“Verklammerungsperspektive” im Rahmenvertrag irrelevant für Verjährung
Die Frage der Anspruchsverjährung habe ich in meinen bisherigen Beiträgen immer aus einem einfachen Grund recht schnell abgehandelt: Unter Bezugnahme auf das BGH-Urteil aus dem Jahr 2011 ist die Uhr für potenzielle Kläger bei der üblicherweise angenommenen Verjährungsfrist von 3 Jahren ab Kenntnis ohnehin am 31.12.2014 abgelaufen. Dabei wird vereinfacht gesprochen unterstellt, dass ein Kunde, der einen Schadensersatz wegen eines nicht offenbarten negativen Marktwertes reklamiert, spätestens mit dem im Jahr 2011 ergangenen BGH-Urteil Kenntnis hätte nehmen können. – Für all diejenigen, die bis Ende 2014 noch keine verjährungshemmenden Maßnahmen ergriffen haben, ist der “negative-Marktwert-Zug” also abgefahren.
Das bedeutet jedoch nicht zwingend, dass es absolut keine Handhabe mehr für Geschädigte gibt, Ersatzansprüche gegen die Bank durchzusetzen. Noch einmal – auch falls es die Leser schon langweilt: Es wird nach meinen Beobachtungen und Erfahrungen in vielen Fällen sinnvoll sein, eine “holistische” Betrachtung des Beratungsverschuldens vorzunehmen. Die unterlassene Offenlegung des negativen Marktwertes ist häufig nur ein Element des Mosaiks von Pflichtverletzungen, auf das Kläger in der Hoffnung auf einen schnellen Urteils-Automatismus vor Gericht bislang vielleicht zu sehr fixiert gewesen sind.
Neue (für Kläger ernüchternde) Konkretisierungen bietet die Pressemitteilung des BGH insbesondere in Bezug auf die “Verklammerungslehre“. Dabei bezogen sich Gerichte auf einen häufig verwendeten Passus in den Geschäftsbestätigungen, der sinngemäß wie folgt lautete: “Dieser Einzelabschluss bildet mit allen anderen zwischen Ihnen und uns abgeschlossenen Einzelabschlüssen, die in den Anwendungsbereich des Rahmenvertrags fallen, einen einheitlichen Vertrag.” [zitiert aus einer Bestätigung der HypoVereinsbank aus dem Jahr 2008]. Aufgrund dieser Vereinbarung, so z.B. das Düsseldorfer OLG (Urteil v. 07.10.2013, Az. I-9 U 101/12), müsse der ökonomische Schaden aller Geschäfte en bloc beurteilt werden. Aufgrund dieser Schadensheinheit könne die Verjährungsfrist auch erst mit dem Abschlusszeitpunkt des letzten abgeschlossenen Derivats beginnen. Somit hätte ein noch relativ “frisches” Geschäft alle ansonsten bereits unter die Verjährung fallenden Geschäfte eines Rahmenvertrags “gerettet”. Der BGH hat in seiner Pressemitteilung klargestellt, dass er nicht bereit ist, dieser Blockbetrachtung zu folgen. Vielmehr verjähre, so der BGH heute, jeder einzelne Abschluss für sich.
Ferner präzisiert die heutige Pressemitteilung mit Blick auf die Verjährungsberechnung, dass der BGH keine (künstliche) Separation zwischen dem Anspruch auf Rückabwicklung eines Vertrags und dem Anspruch auf Entlassung aus noch ausstehenden Zahlungen im Rahmen eines Swap-Geschäftes vornimmt.
Klägerfreundliche Elemente der heutigen Entscheidung
Noch einmal Verklammerung
Wo Schatten ist, ist auch Licht: Die Ablehnung der schadenseinheitlichen Betrachtung im Rahmen der Verklammerungslehre kann auch Vorteile für den Kläger bringen. Dies betrifft Konstellationen, in denen ein Kläger sowohl gewinnbringende als auch verlustreiche Derivatgeschäfte abgeschlossen hat. Die schadenseinheitliche Betrachtung der Geschäfte gebietet, dass sich ein Kläger, der eine Rückabwicklung unter Berufung auf aufklärungsrichtiges Verhalten einfordert, die Gewinne der für ihn positiv verlaufenen Geschäfte auf die aus verlustreichen Geschäften resultierenden Schadensersatzforderungen anrechnen lassen muss.
Betrachtet man – wie der BGH in seiner Pressemeldung klargestellt hat – jeden Swapabschluss separat, so gibt es natürlich auch keinen Anlass für einen Zwang zur Saldierung der Gewinne und Verluste. Ein Kläger kann also theoretisch den “Bruttowert” aller für ihn verlustreich verlaufenen Geschäfte geltend machen und etwaige günstig verlaufene Geschäfte aus einer Klage ausklammern.
Hätte, hätte, Fahrradkette: Beweislast für aufklärungsrichtiges Verhalten
Ein nicht ganz unverständliches Ärgernis für Banken ist in solchen Auseinandersetzungen regelmäßig die Beweislastregelung für das aufklärungspflichtige Verhalten. Hat ein Kunde den Beweis erbracht, dass er im Rahmen einer einstrukturierten Marge von seiner Bank bei Abschluss eines Derivats übervorteilt wurde, so kehrt sich die Beweislast um. Der Kunde muss nicht etwa seine Behauptung des auklärungsrichtigen Verhaltens beweisen, sondern der Bank obliegt ab nun die Widerlegung der Kundenbehauptung, dass er ein Geschäft bei pflichtgemäßer Offenlegung des Anfangsmarktwertes niemals abgeschlossen hätte. Trotz Einsatz ganzer Armaden hochbezahlter Anwälte ist es bislang meiner Kenntnis nach noch keinem einzigen Kreditinstitut gelungen, einen derartigen Widerlegungsbeweis erfolgreich zu führen.
Banken beklagen im Rahmen dieser Regelung immer wieder, dass sie Kläger geradezu zum Rosinenpicken einlädt. Bankvertreter beschweren sich regelmäßig darüber, dass sich noch kein einziger Kunde an sie gewendet habe, der ein aus Kundensicht erfolgreiches Derivatgeschäft rückabwickeln wollte. In der schadenseinheitlichen Betrachtung hätte es der Bank zumindest zugestanden, Gewinne aus für den Kunden erfolgreich verlaufenen Derivaten gegen die Verlustsummen aus den beanstandeten Derivaten zu verrechnen. Der BGH zeigt sich in seiner heutigen Entscheidung aber weiter unnachgiebig: Er stellt in seiner Pressemitteilung klar, dass auch die Tatsache, dass ein Kunde ausschließlich verlustreiche Geschäfte rückabwickeln will und ausgerechnet bei den erfolgreich verlaufenen Geschäfte behauptet, er hätte just diese auch bei korrekter Margenaufklärung abgeschlossen, keinen ausreichenden Beleg dafür darstellt, dass der Kunde eigentlich alle Geschäfte – ob nun mit oder ohne Aufklärung über die einstrukturierte Marge – abgeschlossen hätte.
Konkretisierungsgrad der einstrukturierten Marge bei Offenlegung
Eine weitere spannende Frage, die vor allem die Investmentbanker umtrieben hat, bestand darin, wie konkret der Hinweis auf eine einstrukturierte Abschlussmarge erfolgen muss. Findige Investmentbanker haben nach dem BGH-Urteil im Jahr 2011 sinngemäß gesagt: “OK dann drucken wir ab sofort an das Ende jeder Bestätigung einen Satz wie: ‘Im Rahmen unserer Transparenzinitiative erlauben wir uns den Hinweis, dass die Geschäftskonditionen dieses Einzelabschlusses die bankenübliche Abschlussmarge bereits inkludieren und für Sie somit keine weiteren Abschluss- und Ausführungskosten im Zusammehang mit der Eröffnung dieser Transaktion entstehen.'”
99,99% aller Kunden hätten an einem solchen Vermerk wohl keinerlei Anstoß genommen und wären froh gewesen, dass sie nicht noch irgendeine Provision an die Bank entrichten müssen. Doch wie immer gilt die alte lateinische Weisheit: “Timeo Danaos et dona ferentes”. Die (etwas boswilliger formulierte) Übersetzung hätte nämlich gelautet: “Wenn Sie diese Bestätigung unterschreiben, haben sie bereits X EUR verloren, bevor die Tinte getrocknet ist. – Und wir sind fein raus, denn wir haben Sie ja darauf hingewiesen.” (X ist je nach Geschäftsgröße ein Betrag, der sich wertmäßig irgendwo zwischen Gebrauchtwagen, werksneuer S-Klasse und einem Penthouse-Appartment im VI. oder VII. Arrondissement von Paris bewegt).
Aufmerksame Beobachter der BGH-Rechtsprechung hätten gegen diese Strategie allerdings schon vor der heutigen Entscheidung eingewendet, dass der BGH z.B. auch bei der Offenlegung von Innenprovisionen bei Fondsgeschäften regelmäßig erwartet, dass derartige Beträge auch der exakten Höhe nach offengelegt werden (so z.B. BGH, Beschluss v. 09.03.2011, Az. XI ZR 191/10). Dies hat der BGH in seiner heutigen Entscheidung auch noch einmal für die einstrukturierte Marge klargestellt.
Keine Ausnahmen für “einfacher strukturierte Derivate”
Der wohl wichtigste Punkt aus Klägersicht ist die Klarstellung, dass die Feststellungen des BGH-Urteils aus dem Jahr 2011 unabhängig vom Komplexitätsgrad der Derivatgeschäfte gelten.
Auch hier scheint sich der BGH an dem zuvor erwähnten Urteil des OLG Stuttgart aus dem Jahr 2012 zu orientieren, das in seiner Urteilsbegründung klarstellt, dass Zinsderivate für Außenstehende regelmäßig komplex seien. Diese Klarstellung ist vermutlich für Banken die bitterste Pille, die es am heutigen Tage zu schlucken gilt, denn der Hinweis, dass das Ille-Urteil des BGH ja ein viel komplexeres Geschäft betreffe, welches auf die meisten “einfacheren” Derivate nicht übertragbar sei, ist bis dato eine der beliebtesten Verteidigungsstrategien der Banken gewesen. Dass diese Darstellung einer richterlichen Würdigung nicht standhalten könne, hatte ich bereits in einem Beitrag im Januar vermutet.